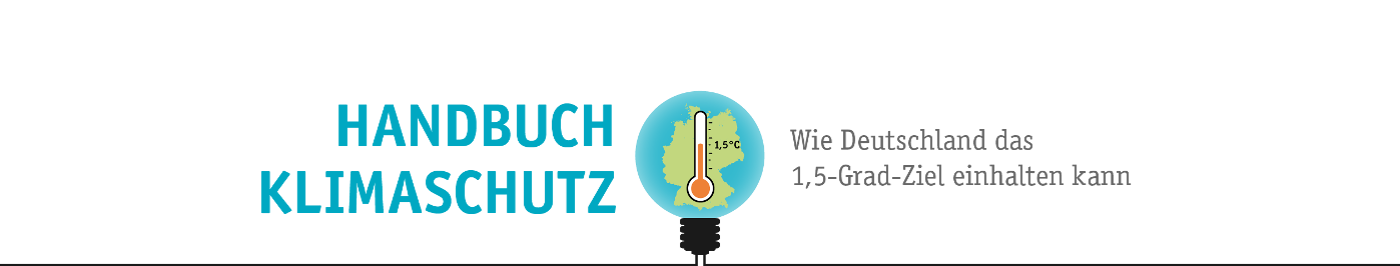Das Handbuch Klimaschutz...
- liefert Basiswissen, Daten und konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz in Deutschland.
- beantwortet eine der drängendsten politischen Fragen unserer Zeit.
- kann der Politik helfen, das Versprechen des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten.
- fasst über 300 aktuelle Studien zusammen. Für Laien verständlich und mit vielen Grafiken.
- legt den ersten Plan vor, der sich am 1,5-Grad-Ziel orientiert.
Dieses Buch ist für…
- interessierte Laien – um sich einen Überblick über das Thema zu verschaffen
- politische Entscheider*innen – um wissenschaftlich fundierte Entscheidungen zu treffen
- Aktivist*innen und Engagierte – um ihre Forderungen auf einen konkreten Plan stützen zu können
Statements
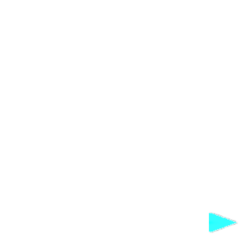

Ortwin Renn
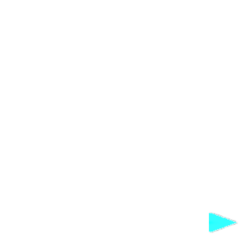

Maja Göpel
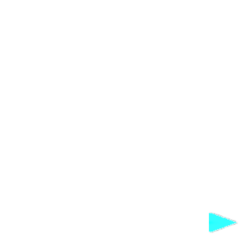

Martin Fischediek
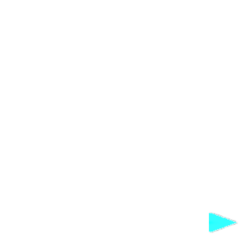

Mojib Latif
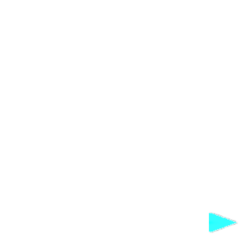

Wolfgang Lucht
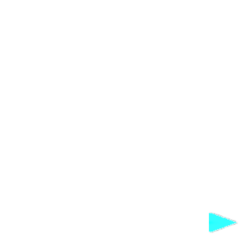

Gregor Hagedorn
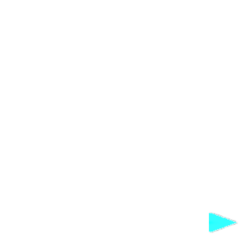

Claudia Kemfert
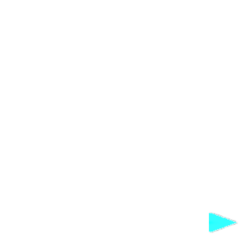

Christian Mathes
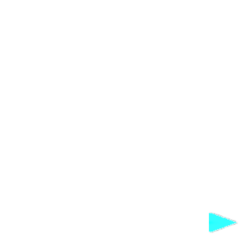

Hintergrund
Deutschland muss sich
ums Klima kümmern. Jetzt!
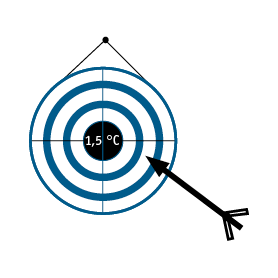
2018 erschien ein großer Bericht des Weltklimarates (IPCC). Er stellt fest: Wir müssen die von Menschen verursachte Erderwärmung auf 1,5-Grad begrenzen. Die Folgen des Klimawandels werden sonst dramatisch und vielleicht unkontrollierbar.
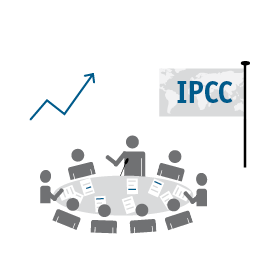
Die meisten Maßnahmenpläne und Politikpakete bisher wollen die Gesellschaft bis 2050 treibhausgas-neutral gestalten. Das würde aber auf eine Erwärmung von mindestens 2,5 Grad hinauslaufen. Das 1,5-Grad-Ziel erfordert laut IPCC-Bericht „rasche, weitreichende und beispiellose Veränderungen“ und „hohe Investitionen“. Aber es ist machbar und für die Wirtschaft unter dem Strich sogar günstiger als abzuwarten und dann mit den schwereren Folgen umzugehen.
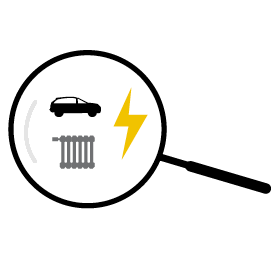
Im Klimaschutz-Abkommen von Paris hat sich Deutschland dem 1,5 Grad-Ziel auch politisch verpflichtet. Wenn man dies ernst nimmt, bedeutet das: Uns bleibt nur noch ganz wenig Zeit, bis keine Emissionen mehr ausgestoßen werden dürfen.
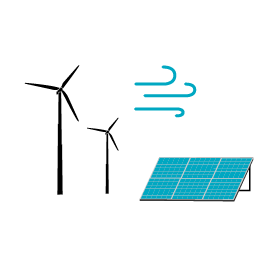
Die gute Nachricht ist: Wir wissen sehr viel und haben gute technische Möglichkeiten, um es schaffen zu können. Die weniger gute Nachricht ist: Die Politik handelt viel zu zögerlich...
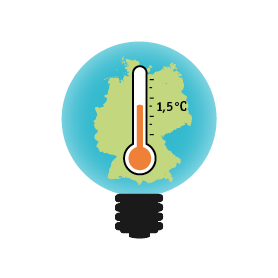
In Deutschland...
- müssen wir unsere Gesellschaft innerhalb von nur 20 Jahren komplett umbauen
- können wir den jährlichen Treibhausgas-Ausstoß schon bis 2035 um 90 Prozent senken
- müssen wir die politischen Entscheidungen den wissenschaftlichen Erkenntnissen anpassen
- werden wir zum Klimaschutz-Vorbild für andere, wenn wir jetzt die Weichen stellen
- können wir durch Klimaschutz unseren Wohlstand bewahren und unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Welt erhalten
Inhaltsübersicht
Das Handbuch zeigt:
So können wir es schaffen!
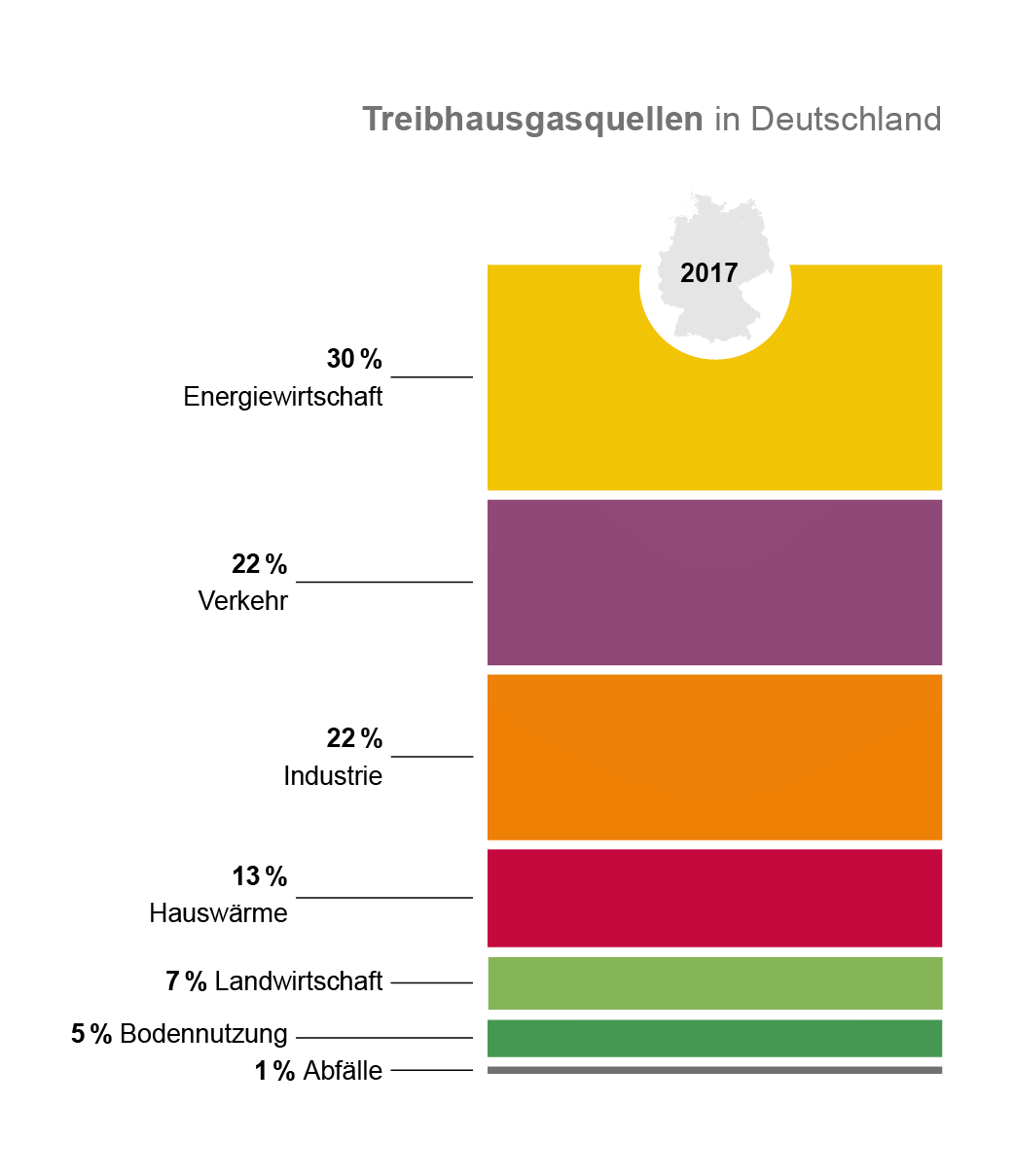
Sektorübergreifende Maßnahmen
Die Umstellung auf Klimaneutralität ist leichter, wenn Rahmenbedingungen stimmen. Dazu gehören auch Veränderungen unserer Gewohnheiten, zum Beispiel in der Ernährung. So lässt sich neben Treibhausgasen auch Energie einsparen, sodass weniger Energieimporte stattfinden müssen. Große Vorhaben wie das Bauen von Stromnetzen dauern heute oft zu lange und müssen zukünftig beschleunigt werden. Dafür ist es auch wichtig, frühzeitig genug Personal auszubilden. Eine konsequente Wiederverwertung garan-tiert in Zukunft, dass keine Rohstoffe mehr verschwendet werden. Viele Menschen sorgen sich wegen der großen Kosten für Klimaschutz. Studien zeigen aber: Zwar erfordert Klimaschutz am Anfang hohe Inves-titionen – langfristig machen sich diese aber bezahlt. Auch der umstrittene CO2-Preis kann so gestaltet werden, dass er Menschen nicht zu sehr belastet.
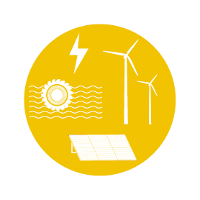
Sektor 1:
Energieversorgung
Wir brauchen Energie: Für Steckdosen zu Hause und Industrie-Anlagen, zum Antrieb von
Fahrzeugen und Heizungen. Heute werden dafür Kohle, Öl und Gas verbrannt. Zukünftig beruht
das Energiesystem auf „grünem Strom“, der umweltverträglich produziert wird. Autos und
Heizungen funktionieren elektrisch. Brennstoffe werden nur noch verwendet, wenn sie aus
grünem Strom hergestellt wurden. Obwohl dadurch Energie einspart werden kann, brauchen wir
drei- bis viermal so viel Strom wie heute. Dazu ist ein schneller Ausbau der Sonnen- und
Windenergie nötig. Zusätzlich werden auch weiterhin Energie-Importe nötig sein. Ein Problem
ist, dass das neue Energiesystem stärkeren Schwankungen ausgesetzt ist, als das alte.
Jedoch können neue Netze und Speicher-Technologien und eine Abstimmung von Stromerzeugung
und -verbrauch die Schwankungen ausgleichen.

Sektor 2:
Hauswärme
Bisher heizen wir unsere Häuser vor allem mit Erdgas und Öl sowie Fernwärme aus
fossilen Kraftwerken. Um Wärme zukünftig klimaneutral zu erzeugen, müssen die
Fernwärmesysteme und die Heizungen vor Ort auf neue Heizsysteme umgestellt werden. Dies
sind vor allem elektrische Wärmepumpen, die aus grünem Strom hocheffizient Wärme
erzeugen. Ergänzt werden diese um Solarthermie-Anlagen, die Sonnenenergie in Wärme
umwandeln und Blockheizkraftwerke, in denen grüner Wasserstoff, grünes Methan und
Reststoffe aus der Landwirtschaft verbrannt werden. Da der Strombedarf im Wärmesektor
stark wächst, müssen künftig neunzig Prozent aller Gebäude gut gedämmt sein – dies kann
den Energiebedarf mehr als halbieren. Dieses Vorhaben gehört zu den teuersten und
schwierigsten Aufgaben der bevorstehenden Umstellung.

Sektor 3:
Verkehr
Der Treibhausgas-Ausstoß des Verkehrs ist seit Jahrzehnten nicht gesunken, denn das
Verkehrsaufkommen steigt ständig an. Das gilt für Personen- und Güterverkehr – auf den
Straßen, auf dem Wasser und in der Luft. Dieser Trend muss sich umkehren. Städte
brauchen attraktive Radwege und einen guten öffentlichen Nahverkehr. Damit so viel
Verkehr wie möglich von Autos und LKW auf die Bahn verlagert werden kann, müssen die
Bahnstrecken ausgebaut und in dichterem Takt befahren werden. Der künftige Verkehr muss
klimaneutrale Antriebe nutzen: das Elektroauto ersetzt daher die Verbrenner. Autobahnen
werden mit Oberleitungen versehen, damit auch LKW elektrisch fahren können. Schiffe und
Flugzeuge werden mit E-Brennstoffen betankt.

Sektor 4:
Industrie
Die Industrie verursacht 22 Prozent der Emissionen in Deutschland. Zwei Drittel davon
stammen aus dem Energieverbrauch und können durch Elektrifizierung und Verwendung grüner
Brennstoffe vermieden werden. Problematisch sind Emissionen, die durch chemische
Prozesse entstehen: Die Stahlproduktion kann nach Umbaumaßnahmen klimaneutral erfolgen.
Die Emissionen bei der Zement-Herstellung können aber nur vermieden werden, wenn weniger
davon verbaut wird. Die Chemieindustrie verbraucht bisher große Mengen an fossilen
Rohstoffen, die durch elektrisch erzeugte grüne Rohstoffe ersetzt werden müssen. Die
notwendigen Investitionen für die Umstellung werden aber nur erfolgen, wenn verlässliche
politische Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu zählen ein Treibhausgas-Preis und
je nach Branche eine Umstellungsförderung.

Sektor 5-7:
Landwirtschaft,
Bodennutzung und Abfälle
Die Produktion von Nahrung verursacht Emissionen, vor allem die Tierhaltung und die
Düngung von Feldern. Insbesondere die Rinderhaltung und somit der Fleisch- und
Milchkonsum müssen um mindes-tens die Hälfte zurückgehen. Auch der Einsatz von
Stickstoffdünger muss stark reduziert werden. Mit der Landwirtschaft hängt die
Bodennutzung im In- und Ausland eng zusammen. Je nach Nutzung können Flächen
Treibhausgas verursachen – oder reduzieren. Wald entzieht der Luft Kohlendioxid.
Trockengelegte Moore hingegen dünsten viel Treibhausgas aus. Der ineffiziente Anbau von
Energiepflanzen (Mais und Raps) wird eingestellt. Dafür werden unter anderem Moore
wieder vernässt und neue Wälder gepflanzt. Im Abfall-Sektor müssen die Emissionen der
Altdeponien beendet werden.
Über uns
Wer steht hinter dem Handbuch Klimaschutz?
Auftraggeber sind die Vereine Mehr Demokratie e.V. und BürgerBegehren Klimaschutz e.V.

Mehr Demokratie e.V. ist die weltweit größte Nichtregierungsorganisation für direkte
Demokratie und hat den ersten deutschlandweiten Bürgerrat mit ausgelosten Menschen
initiiert. Der Verein ist gemeinnützig und überparteilich.
MEHR INFOS

BürgerBegehren Klimaschutz e.V. (BBK) ist ein gemeinnütziger Verein, der 2008 gegründet
wurde. Sein Ziel ist es, bundesweit Klimaschutzmaßnahmen durch Bürgerbegehren und
Bürgerentscheide durchzusetzen.
MEHR INFOS
Das Handbuch ist als Vorarbeit zur Durchführung eines Klima-Bürgerrats entstanden.
Mehr zur Idee eines Klima-Bürgerrats
Die Autorinnen und Autoren:
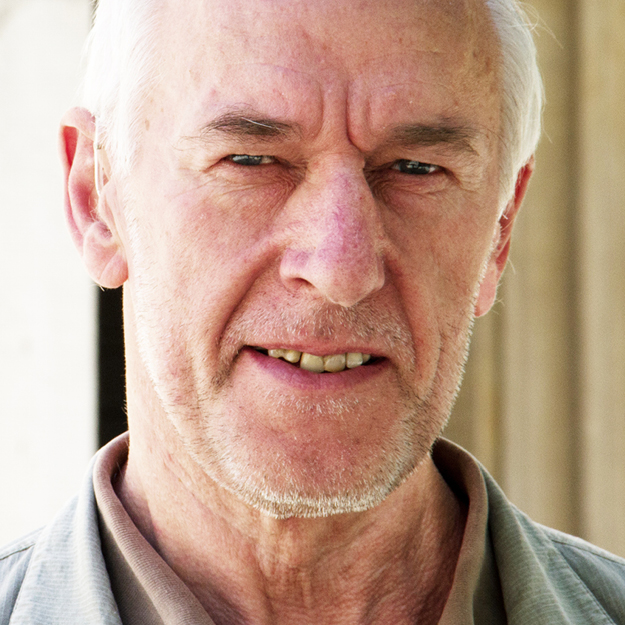
Karl-Martin Hentschel (Projektleiter):
Karl-Martin Hentschel wurde 1950 in Bad Münder/Niedersachsen geboren. Nach dem Mathematikstudium in Kiel arbeitete er als Systemprogrammierer, Datenbankmanager und zuletzt als Abteilungsleiter für Neue Technologien in einem internationalen Konzern in Hamburg. Von 1996 bis 2009 war er Abgeordneter (davon 9 Jahre als Fraktionsvorsitzender) für Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Schleswig-Holstein, von 1996 bis 2005 in der Koalition mit der Ministerpräsidentin Simonis. Er stellte das erste Szenario »100 Prozent erneuerbarer Strom für Schleswig-Holstein« vor, das in den Folgejahren umgesetzt wurde.
Nach seinem Ausscheiden aus der Politik arbeitete er als Autor und Referent. Unter anderem schrieb er »Es bleibe Licht«, ein Buch über die Techniken, Ökonomie und Politik der Umstellung Europas auf erneuerbare Energien. Seitdem beschäftigt er sich mit der Schnittstelle zwischen gesellschaftlicher Transformation und Demokratie. Er arbeitet ehrenamtlich im Bundesvorstand von Mehr Demokratie e. V. und in der AG Finanzmärkte und Steuern von Attac sowie im Vorstand des Netzwerk Steuergerechtigkeit e.V.

Steffen Krenzer
Steffen Krenzer ist Umweltpsychologe und beschäftigt sich mit psychischen und sozialen Prozessen im Kontext von Klimapolitik und gesellschaftlicher Transformation. Er leitet das Projekt "Die Klimadebatte" bei Mehr Demokratie.
Team:
Claudia Bielfeldt, Biologin
Jessica Hentschel, Juristin
Anja Twest, biol. Ozeanographin
Hermann Hell, Physiker und Energieberater
Lea Johannsen, Psychologin und Mathematikerin